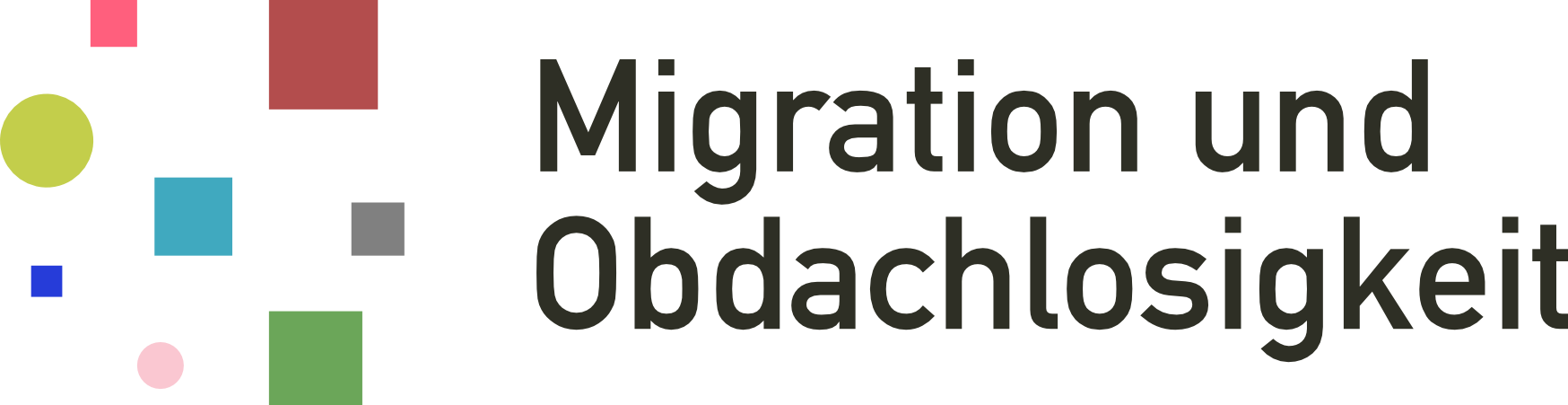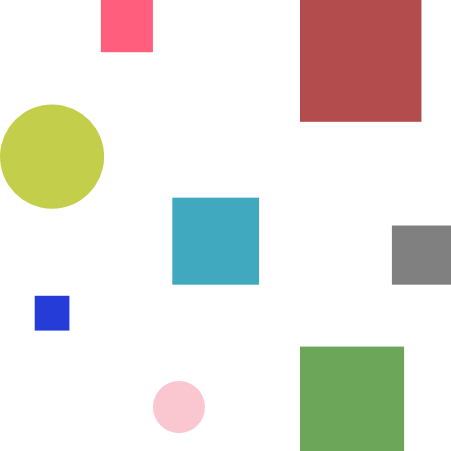Von Kenan Engin
Wohnungslosigkeit wird in Deutschland als ein zentrales soziales Problem betrachtet, das durch einen Mangel an ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen sowie eingeschränkte Wahl- und Handlungsmöglichkeiten geprägt ist. Gesellschaftlich wird Wohnungslosigkeit häufig als nonkonformes Verhalten interpretiert, was zur Stigmatisierung der Betroffenen führt. Dieser Prozess des „Othering“ wird der Heterogenität und Komplexität der Lebenssituationen wohnungsloser Menschen nicht gerecht.
In den letzten Jahren ist das Risiko für verschiedene Bevölkerungsgruppen, wohnungslos zu werden, deutlich gestiegen. Gründe dafür sind unter anderem steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Miet- und Energiekosten stark erhöht haben. Miet- und Energieschulden sind eine der häufigsten Ursachen für Wohnungslosigkeit.
Wohnungslose Migrant*innen: Eine vernachlässigte Perspektive
Während Wohnungslosigkeit zunehmend erforscht wird, insbesondere bei Gruppen wie Frauen, Jugendlichen und queeren Personen, bleibt die Schnittstelle zwischen Migration und Wohnungslosigkeit weitgehend unerforscht. Migrant*innen sind jedoch besonders von Armut betroffen und daher überproportional gefährdet, wohnungslos zu werden. Trotz der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Relevanz von Migration ist ihre Verknüpfung mit Wohnungslosigkeit in der deutschen Forschungslandschaft noch eine Ausnahme.
Die Beschäftigung mit wohnungslosen Migrant*innen erfordert eine Kategorisierung nach rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kriterien. Dabei werden Migrant*innen je nach Art der Migration (z. B. Arbeitsmigration oder Fluchtmigration), Herkunftsländern, Bildungsabschlüssen oder anderen Merkmalen unterschiedlich eingeordnet. Ebenso wird Wohnungslosigkeit anhand von Aspekten wie rechtlicher Absicherung, Privatsphäre und sozialer Einbindung klassifiziert.
Diese Kategorisierungen sind jedoch primär Ausdruck politischer und rechtlicher Handlungszwänge und weniger das Ergebnis empirischer oder theoretischer Forschung. In der Praxis führt dies dazu, dass Migrant*innen oft mehreren Zuständigkeitsbereichen gleichzeitig zugeordnet werden, was die Hilfsangebote für sie erschwert.
EU-Migrant*innen
EU-Bürger*innen haben durch die Freizügigkeit das Recht, sich in anderen EU-Ländern aufzuhalten und zu arbeiten. Dennoch sind sie oft von Wohnungslosigkeit betroffen, vor allem durch prekäre Arbeitsverhältnisse, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt oder fehlende Sozialleistungen. Viele EU-Migrant*innen erleben eine „Phase des prekären Ankommens“, in der sie keinen Wohnraum finden und von Anfang an wohnungslos sind.
Geflüchtete Menschen
Geflüchtete sind oft traumatisiert durch ihre Fluchterfahrungen und leben unter schlechten Bedingungen in Gemeinschaftsunterkünften, die häufig keine menschenwürdigen Wohnbedingungen bieten. Junge Geflüchtete sind besonders betroffen, da sie beim Erreichen der Volljährigkeit die Jugendhilfe verlassen müssen und oft keine Wohnung finden.
Statistische Herausforderungen und Forschungslücken
Die Erfassung von wohnungslosen Migrant*innen gestaltet sich schwierig, da ihre genaue Zahl von der Kategorisierung und Definition abhängt. Laut einer Hochrechnung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) waren im Jahr 2022 von den 607.000 wohnungslosen Menschen in Deutschland etwa 411.000 Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Der Anteil der nicht-deutschen Wohnungslosen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 118 %.
In den Statistiken sind jedoch nicht alle Gruppen erfasst, wie z. B. Migrant*innen, die bei Freunden oder Familie unterkommen oder obdachlos sind. Besonders osteuropäische Migrant*innen aus Ländern wie Polen, Bulgarien und Rumänien stellen eine große Gruppe unter den wohnungslosen Migrant*innen dar.
Forschungslücken und intersektionale Perspektiven
Wissenschaftliche Studien zu wohnungslosen Migrant*innen sind oft auf institutionelle Settings begrenzt, wie beispielsweise die Sozialarbeit. Dies führt dazu, dass schwer erreichbare Gruppen wie migrantische Frauen oder junge Geflüchtete unterrepräsentiert bleiben. So sind viele migrantische Frauen verdeckt wohnungslos, während Jugendliche häufig ohne Ankündigung Jugendhilfeeinrichtungen verlassen und unklar ist, wo sie unterkommen.
Ethnographische Studien und intersektionale Analysen fehlen weitgehend, obwohl sie wichtig wären, um die individuellen und strukturellen Ursachen von Wohnungslosigkeit bei Migrant*innen zu verstehen. Forschung könnte dabei helfen, politische und praktische Maßnahmen zu entwickeln, um Wohnungslosigkeit zu verhindern oder zu bewältigen.
Das Forschungsprojekt „ZuWoMi
Das studentische Forschungsprojekt „ZuWoMi“ an der Technischen Hochschule Nürnberg versucht, die Themen Migration und Wohnungslosigkeit empirisch zu verbinden. Ziel ist es, herauszufinden, wie wohnungslose Migrant*innen für Forschungsprojekte erreicht werden können. Dabei werden verschiedene Methoden getestet, um erste Erkenntnisse über die Lebenssituationen und Herausforderungen dieser Zielgruppe zu gewinnen.
Die Ergebnisse zeigen, dass migrationsbedingte Herausforderungen und intersektionale Benachteiligungen den Zugang zu dieser Gruppe erschweren. Gleichzeitig geben sie Hinweise darauf, welche Strategien hilfreich sein könnten, um wohnungslose Migrant*innen besser zu unterstützen.
Zusammenfassung
Die wachsende Zahl wohnungsloser Migrant*innen in Deutschland zeigt einen dringenden Handlungsbedarf für Wissenschaft und Praxis. Eine umfassendere Erforschung der Lebenslagen, Bedarfe und Unterstützungsbedarfe dieser Gruppe ist notwendig, um gezielte und effektive Maßnahmen entwickeln zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, institutionelle und strukturelle Barrieren abzubauen und neue Zugänge zu dieser Zielgruppe zu schaffen.
(Der Text ist eine kurze Zusammenfassung vom Forschungsbericht „Schnittstelle Migration
und Wohnungslosigkeit“ 2022, in: file:///Users/user/Downloads/Schriftenreihe_PWW_Band_04.pdf)