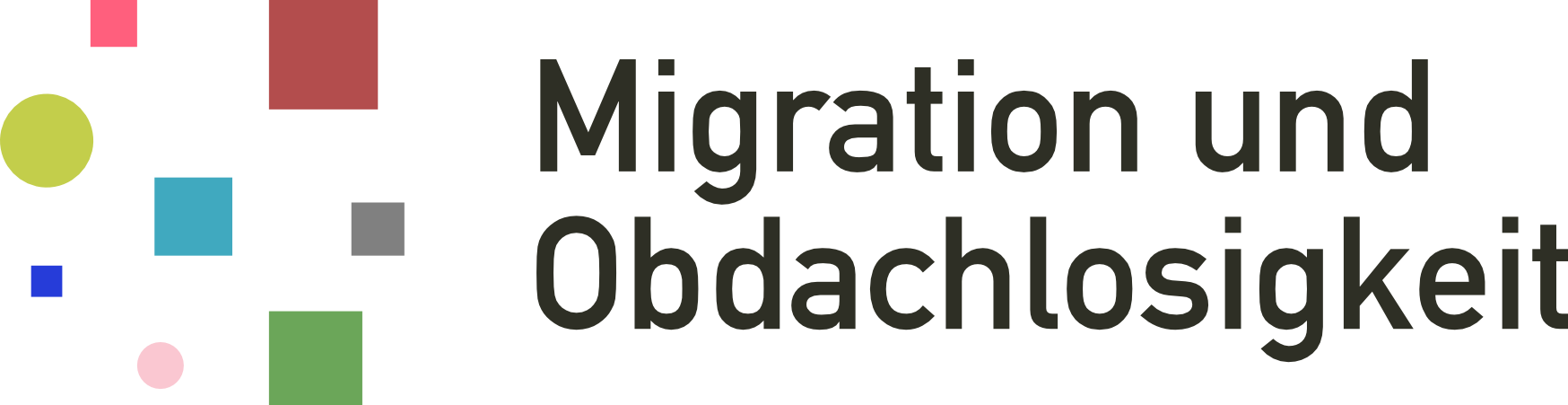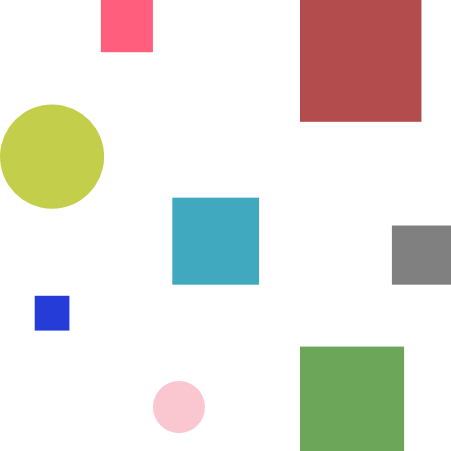Von Kenan Engin
Der Sozialbericht 2024 der Bundeszentrale für politische Bildung beleuchtet die zunehmend angespannte Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt und die damit einhergehenden sozialen Probleme. Besonders betroffen sind Ballungsräume und Großstädte, in denen die Mietpreise kontinuierlich steigen und bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird. Diese Entwicklung trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die sich die hohen Mieten oft nicht mehr leisten können und dadurch in prekäre Lebenssituationen geraten. Die Folge ist eine zunehmende soziale Ungleichheit und Verdrängung von einkommensschwachen Haushalten aus zentralen Stadtlagen.
Ein besonders wichtiges Problem ist die Wohnungslosigkeit, die im Jahr 2023 mit rund 372.000 gemeldeten Fällen einen neuen Höchststand erreichte. Dies bedeutet eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr (2022), als etwa 178.000 Personen als wohnungslos registriert waren. Dieser Anstieg ist zum großen Teil auf die Aufnahme von etwa 130.000 Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen, die nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst wohnungslos waren. Daneben spielte auch eine Verbesserung der Datenerhebung eine Rolle, wodurch mehr Fälle erfasst wurden als zuvor.
Die meisten wohnungslosen Menschen wurden in den bevölkerungsreichsten Bundesländern untergebracht: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin. Diese Bundesländer stehen vor großen Herausforderungen bei der Unterbringung und Betreuung der Betroffenen. Auf der anderen Seite verzeichneten Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und das Saarland die geringsten Zahlen an wohnungslosen Personen, was auf die im Vergleich geringere Bevölkerungsdichte und die spezifische Sozialstruktur in diesen Regionen zurückzuführen sein könnte.
Ein bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Statistik ist die Veränderung im Geschlechterverhältnis unter den Wohnungslosen. Während im Jahr 2022 noch etwa 62 % Männer betroffen waren, sank dieser Anteil im Jahr 2023 auf 50 %, während der Anteil der Frauen auf 42 % stieg. Zusätzlich wurden bei 7 % der gemeldeten Personen keine Angaben zum Geschlecht gemacht. Das Durchschnittsalter der Wohnungslosen liegt bei 31 Jahren, und über ein Viertel der Betroffenen ist unter 18 Jahre alt, was die Dringlichkeit präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit bei jungen Menschen und Familien unterstreicht.
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Wohnungslosigkeit ist der Migrationshintergrund vieler Betroffener. Studien zeigen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte überproportional häufig von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Dies liegt unter anderem an strukturellen Benachteiligungen auf dem Wohnungsmarkt, wie etwa Diskriminierung bei der Wohnungssuche, Vorurteilen seitens der Vermieter sowie Sprachbarrieren, die den Zugang zu Informationen und Hilfsangeboten erschweren.
Soziologisch betrachtet spielt die soziale Exklusion eine zentrale Rolle. Migrantinnen und Migranten, insbesondere aus sozial schwachen und bildungsfernen Milieus, sind häufig schlechter in den Arbeitsmarkt integriert und verfügen daher über geringere finanzielle Ressourcen. Fehlende Netzwerke und Unterstützungsstrukturen vor Ort verstärken das Risiko, wohnungslos zu werden. Auch prekäre Arbeitsverhältnisse und die Unsicherheit im Aufenthaltsstatus tragen zur Wohnungsnot bei, da stabile Mietverhältnisse oft an ein gesichertes Einkommen geknüpft sind.
Politisch gesehen resultiert die prekäre Wohnsituation vieler Menschen mit Migrationshintergrund auch aus einer unzureichenden Sozialpolitik, die wenig Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe nimmt. Integrationsprogramme, die den Zugang zu Bildung und Arbeit fördern, greifen oft zu kurz, um die komplexen Probleme von Wohnungslosigkeit nachhaltig zu lösen. Zudem sind geflüchtete Menschen aufgrund ihres rechtlichen Status häufig auf temporäre Unterkünfte angewiesen, die langfristig zu prekären Lebensverhältnissen führen können.
Der Sozialbericht 2024 betont, dass die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit bei Migrantinnen und Migranten ein ganzheitliches Konzept erfordert, das Diskriminierung abbaut, Arbeitsmarktintegration fördert und Zugang zu dauerhaftem, bezahlbarem Wohnraum gewährleistet. Nur durch eine umfassende politische Strategie können die Ursachen von Wohnungsnot wirksam angegangen und soziale Teilhabe ermöglicht werden.
Hinweis: Der Sozialbericht (vormals Datenreport) wird von der Bundeszentrale für politische Bildung / bpb in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt (Externer Link:Destatis), dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Externer Link:WZB) und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Externer Link:BiB) herausgegeben.
Quelle: https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Sozialbericht_2024_bf_k2.pdf