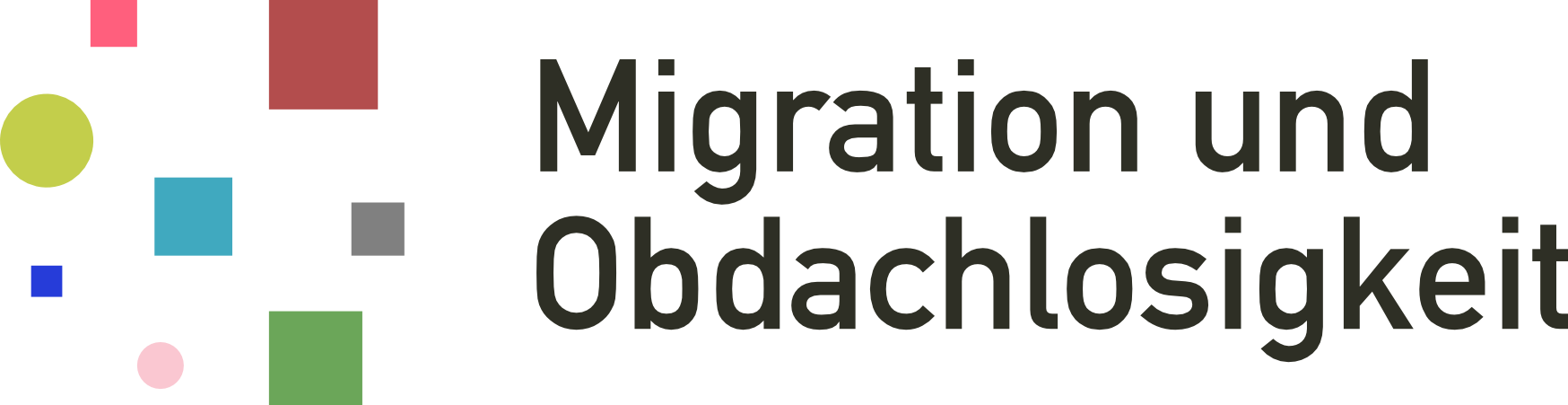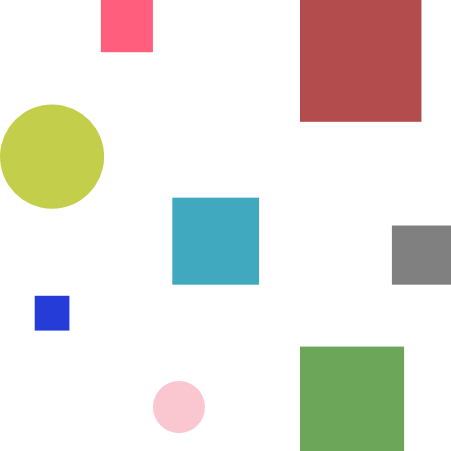Von Kenan Engin
Zwischen 2002 und 2012 untersuchte das Projekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) an der Universität Bielefeld systematisch, wie tief Vorurteile und Abwertungen gegenüber verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in der deutschen Bevölkerung verankert sind. Die jährlichen Befragungen lieferten ein eindrückliches Bild: Menschenfeindliche Einstellungen sind kein Randphänomen, sondern reichen weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Besonders deutlich wurde dies im Hinblick auf Rassismus und die Abwertung von Obdachlosen.
Rassistische Einstellungen zeigten sich über die gesamte Erhebungsdauer hinweg stabil – etwa ein Viertel der Befragten äußerte regelmäßig Zustimmung zu Aussagen wie „In Deutschland leben zu viele Ausländer“. Dabei war auffällig, dass offene Ablehnung seltener wurde, während subtile, kulturell codierte Formen des Rassismus an Bedeutung gewannen. Diese Form des „latenten Rassismus“ ist besonders problematisch, weil sie gesellschaftlich weniger geächtet ist, aber dennoch Ausgrenzung legitimiert. Die Studie zeigte zudem, dass rassistische Haltungen vor allem dort verbreitet sind, wo Unsicherheit herrscht – sei es ökonomisch, kulturell oder politisch. Besonders stark vertreten waren sie bei Menschen mit autoritärer Grundhaltung und niedriger Bildung.
Auch die Haltung gegenüber Obdachlosen offenbarte tief sitzende soziale Spaltungen. Zwar ist die physische Präsenz obdachloser Menschen in Städten unübersehbar, doch wird sie von vielen als störend empfunden. Aussagen wie „Obdachlose stören das Stadtbild“ erhielten signifikante Zustimmung. Die Studie zeigte, dass viele Menschen Armut und Wohnungslosigkeit nicht als strukturelles Problem, sondern als individuelles Versagen betrachten. Diese moralische Schuldzuschreibung wurzelt in einer verbreiteten Leistungsideologie, die davon ausgeht, dass jeder für sein Schicksal selbst verantwortlich ist. Wer diesem Weltbild folgt, begegnet wohnungslosen Menschen oft mit Verachtung statt Solidarität.
Insgesamt macht das Projekt deutlich, dass Rassismus und Obdachlosenfeindlichkeit Ausdruck eines tiefer liegenden gesellschaftlichen Problems sind: einer Tendenz zur Ausgrenzung von Menschen, die als „anders“ oder „weniger wert“ wahrgenommen werden. Die Studie fordert daher nicht nur politische Maßnahmen gegen Diskriminierung, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit dominanten sozialen Leitbildern – insbesondere mit dem Glauben an individuelle Leistungsfähigkeit als einzigem Maßstab gesellschaftlicher Zugehörigkeit.